Alle suchen es. Alle wollen es. Ein kleines oder vielleicht auch ein etwas größeres
Stück vom Glück. „Haben wir nicht sogar ein Anrecht auf Glück„, vermag ich aus einigen Gesichtern zu lesen. Manchmal auch aus meinem. Ein Anrecht auf Glück. Gibt es so etwas? Haben wir ein Recht auf Glück? Ich weiß es nicht, aber wenn ich ehrlich bin, würde ich es mir hin und wieder wünschen. Es gibt Tage, an denen schätze ich mich glücklich. Sehr glücklich. Überaus glücklich. Da scheint mich das Glück anzulächeln und das Beste ist: es hört gar nicht mehr auf zu lächeln! Aber es gibt auch die anderen Tage. Die Tage, an denen ich mich vom Glück verlassen fühle. Ja, an diesen Tagen fühle ich mich sogar vom Pech verfolgt, ein wenig zumindest. Ganz nach dem Motto: Tschüss Glück. Hallo Pech.
„Hallo Pech“ – das habe ich in der letzten Zeit oft gesagt. Häufig bin ich in den letzten zwei Jahren an meine Grenzen gestoßen. Ich habe den Blick für „Alles hat etwas positives“ verloren. Mein „Inklusion-Welcome-Kampfgeist“ hat gelitten. Stark gelitten. Es sind Dinge passiert, die konnte ich mir nicht mehr schön reden. Egal von welcher Seite ich sie betrachtet habe, sie hatten einfach nichts positives und schönes an sich. Ein Kind mit einer Behinderung zu haben, ist oftmals schwierig. Größtenteils ist es harte Arbeit. Mein kleiner Michel wird älter und es treten Probleme auf, die ich vor ein paar Jahren weggelacht habe. Heute funktioniert das nicht mehr. Umso größer mein Michel wird, umso weniger passen wir in das System. Nicht, dass wir früher super hinein gepasst hätten, aber irgendwie haben wir es immer geschafft uns hinein zu mogeln. Irgendwie hatte ich damals noch das Gefühl, wir gehören dazu. Das funktioniert heute nicht mehr. Zumindest werden wir ziemlich schnell, eigentlich SOFORT, ertappt und enttarnt.
„Ihr kommt hier nicht rein. Und Tschüss!“ Oder „Ihr müsst wieder raus. Und Tschüss!“
„Die Leuten sollen sich mal nicht so anstellen“ – Mitmenschen, die diesen Spruch (mehr ist es leider nicht) von sich geben, sind meistens die Menschen, die nach Evans ersten Wutanfall ihre Augen verdrehen und ihre Nase rümpfen. Ehrliche Inklusion sieht anders aus und fühlt sich definitiv anders an. Reaktionen, Kommentare, Äußerungen, die früher an mir herabgeprallt sind, treffen mich heute mehr. Gehen tiefer. Warum? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist mein Mutterschutzschild an manchen Stellen schon so überstrapaziert. Vielleicht merke ich aber auch immer mehr, dass Evans Verhalten in manchen Situationen einfach nicht mehr gesellschaftsfähig ist, nicht mehr zumutbar ist. An manchen Stellen sogar eine Gefahr besteht. Ein soziales Leben mit einem behinderten Kind zu leben, ist harte Arbeit. Manchmal, in letzter Zeit sehr oft, fehlt mir die Kraft alleine für das Organisieren, so dass ich im Endeffekt lieber auf ein Treffen mit Freunden verzichte. Einige Freundschaften halten das aus. Einige nicht.
Hinzu kommt, dass sich in den letzten zwei Jahren nicht nur meine Gefühlsebene verändert hat, sondern auch unsere Familienkonstellation. Mittlerweile leben Evan und ich in einem Patchworkkonstrukt. Aus 2 wurden 4. (Nummer 3 war letztes Jahr übrigens mein absolutes Glück. Das reine Glück. Nummer 4 war es ein Jahr davor und ist es immer noch). Meine Illusion von “Patchworkbilderbuchidylle at hoc“ hat sich in “Patchwork ist harte Arbeit besonders mit einem behinderten Kind“ verwandelt. Neben meinem Evan gibt es jetzt noch zwei weitere Menschen in meinem Leben, mit ganz eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Oftmals sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich und durch Evans Behinderung stark belastet. „Einfach mal so“ geht bei uns nicht. Einfach mal so über den Weihnachtsmarkt zu gehen, einfach mal so ein Eis essen, einfach mal so spazieren gehen. All das was man als normal und alltäglich betrachtet ist für uns nicht möglich. Zumindest nicht in der Viererkonstellation. Dieser Umstand belastet mich sehr und macht mich traurig. So sehr ich mein Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga Leben auch liebe, manchmal sehne auch ich mich nach etwas langweiliger Normalität. (Übrigens hat sich mein Bild von einer „in meiner Elternzeit entdecke ich viele neue Talente und bin kreativ“ ziemlich schnell in „ich bin einfach nur müde und versuche das Chaos in den Griff zu bekommen“ verändert. So viel zum Thema Bilderbuch und Idylle.)
Ende gut alles gut? Nicht ganz. Leider ist es nicht immer so einfach. Aber was einfach, ganz einfach ist, ist die Liebe. Die Liebe zu meinen Kindern. So schwer das Leben mit Evans Behinderung auch sein mag, die Liebe zu Evan kann es nicht im Geringstes erschüttern. Alle Äußerungen, Ablehnungen, Kommentare, verdrehten Augen, rümpfenden Nasen und „einfach mal sos“ sind lächerlich im Vergleich zu dieser Liebe. Diese Liebe gibt mir Kraft. Jeden Tag aufs Neue. So mehr ich mich mit diesem Artikel auseinandersetzte, so mehr ich schreibe, umso bewusster wird mir, dass es egal ist, ob das Glücksgefühl oder das Pechgefühl bei einem eingezogen ist, denn die Liebe übertrifft beide. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es okay ist, wenn man an seine Grenzen stößt. Das es okay ist, wenn man neue Wege einschlägt und alte hinter sich lässt. Es ist okay, wenn Freundschaften zerbrechen. Es ist okay, wenn man sich vom Glück verlassen fühlt und vom Pech verfolgt. Ich habe gelernt, dass alles okay ist.
(P.S. Am Ende meiner Elternzeit werde ich mir doch noch eine Nähmaschine kaufen und mich kreativ finden und betätigen.)
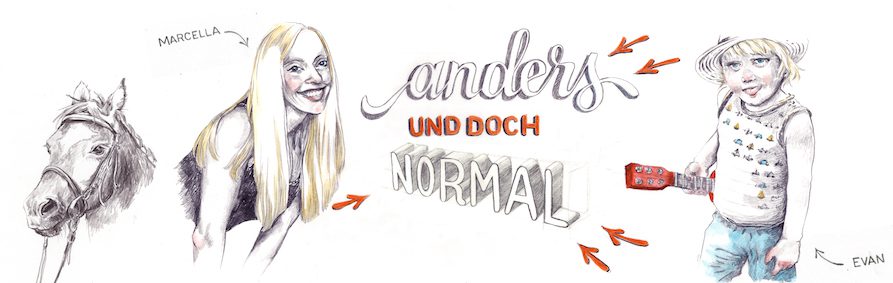

8 Kommentare